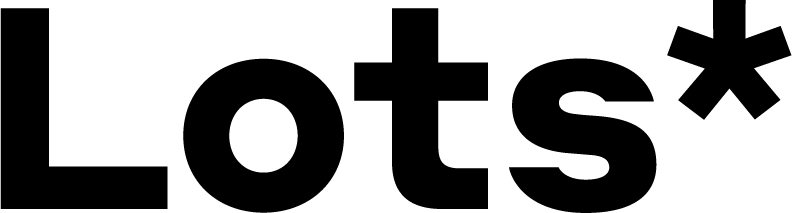Wie müssen Gebäude geplant werden, damit sie möglichst klimaresilient sind? Wie wirkt sich das auf die Gesundheit der Bewohner*innen aus? Welchen Vorteil hat es für eine klimagerechte Stadt? Und welche Kommunikationsstrategien sind dafür nötig? Lots* sprach dazu mit Prof. Dr.-Ing. Anika Möcker, Professorin für Nachhaltiges Bauen und Betreiben an der Hochschule Mittweida.
Frau Prof. Möcker, wie könnte man heute schon weitgehend nachhaltig bauen?
Meine erste Antwort ist vielleicht etwas seltsam: nämlich gar nicht bauen, sondern den Bestand nutzen. Jeder Quadratmeter, der keine sogenannte graue Energie in der Herstellungsphase hat und später auch nicht beheizt, gelüftet, beleuchtet und gereinigt werden muss, ist wertvoll im Sinne der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Deswegen sollte die erste Frage nicht sein, wie wir nachhaltig bauen können, sondern wie wir es vermeiden können zu bauen.
Wenn wir es wirklich nicht vermeiden können, dann sollten wir zunächst mit nachwachsenden und natürlichen Baustoffen bauen, beispielsweise mit Lehm, Holz, Naturstein, Holzfaser-Baustoffen oder Hanf. Stichwort Recycling: Plattformen wie Concular untersuchen, welche Bauteile wiederverwendet oder recycelt werden können. Auch die Ausrichtung der Gebäude an der Sonnenenergie ist ein Prinzip nachhaltiger Architektur. Im Sommer sollten wir geringe Wärmeeinträge haben, um die Kühlkosten zu minimieren, und im Winter sollten wir die Sonne nutzen, um Heizkosten zu sparen.
Ein weiterer Aspekt ist der Flächenverbrauch. Egal ob Wohnungsbau oder Bürogebäude, der Pro-Kopf-Flächenverbrauch sollte reduziert werden. Das gelingt durch einfache Sharing-Prinzipien, so dass Flächen für verschiedene Nutzungen verfügbar sind. Im gewerblichen Bereich könnten Büroflächen abends für Veranstaltungen oder Sport genutzt werden.
Nicht zuletzt ist es auch wichtig, den Rückbau von Anfang an mitzudenken, so dass Gebäude nach einer bestimmten Nutzungsdauer demontiert und wiederverwendet werden können. Modulare Bauweise ist hier ein Stichwort.
Wie müssen Gebäude geplant werden, damit sie möglichst klimaresilient sind?
Das ist eine interessante Frage, weil sie sich auf ein großes Missverständnis bezieht, das oft zu einem hohen Ressourcenverbrauch führt. Wir wissen, dass sich das Klima künftig verändern wird, mit mehr Dürre- und Hitzeperioden sowie stärkeren Stürmen und Regenfällen. Und viele denken, dass wir diese Veränderungen mit immer mehr Technik bewältigen müssen.
Aber wir können auch klimaresilient bauen, indem wir ein minimalistisches Technikkonzept verfolgen. Statt immer mehr Technik in Gebäuden einzubauen, um Hitzeperioden zu bewältigen, können wir Baustoffe mit hoher thermischer Speicherfähigkeit verwenden. Das schafft ein angenehmes Raumklima ohne zusätzliche Kühlung. Wir sollten auch auf Glasfassaden verzichten und stattdessen Baustoffe wie Lehm, Stroh, Hanf oder Flachs verwenden, die gut dämmen und thermisch speichern. Zusätzlich können äußere Verschattungen oder Gebäudevorsprünge die Wärme im Sommer draußen halten.
Ein Beispiel ist das Bürogebäude 2226 in Lustenau in Vorarlberg, das mit 76 cm dicken Steinwänden gebaut wurde und kaum Technik benötigt. Es hat weniger gekostet als vergleichbare techniklastige Gebäude und wird eine Lebensdauer von mindestens 100 bis 150 Jahren haben. Und: Es benötigt keine Heizung, Kühlung oder Lüftung.
Weitere einfache und natürliche Maßnahmen wie Fassadenbegrünung, Gründächer und Grünflächen um das Gebäude verbessern durch Verdunstungskühlung das Mikroklima und fördern die Biodiversität.
Was fehlt Ihnen hier am ordnungsrechtlichen Rahmen, um solche Bauweisen zu befördern?
Man sollte nicht nur auf die Investitionskosten schauen, sondern vor allem auf die Lebenszykluskosten. Über den Lebenszyklus betrachtet, wird schnell klar, welche Variante ressourcenschonender ist. Die Ökobilanzdaten müssten ebenfalls in Entscheidungen einbezogen werden.
Ein weiterer Punkt ist die Energieeffizienz. Deutschland ist hier Spitzenreiter im energieeffizienten Bauen, denn wir haben vergleichsweise hohe Standards. Aber der Flächenverbrauch pro Person ist gestiegen. Das bedeutet, dass wir trotz besserer Gebäudeeffizienz nicht weniger Energie verbrauchen, weil die bewohnte Fläche zugenommen hat. Um Ressourcen besser und nachhaltiger zu nutzen, sollten wir Bestandsgebäude umnutzen und umbauen, anstatt neu zu bauen. Ordnungsrechtliche Maßnahmen könnten hier helfen, indem weniger Neubaugebiete ausgewiesen werden.
Wie kann es gelingen, Gebäude auch effizienter und nachhaltiger im Betrieb zu führen?
Wasser ist dafür ein immer wichtiger werdendes Thema. Momentan sind die meisten Regenwassernutzungsanlagen noch unwirtschaftlich. Aber das wird sich ändern, da die Wasser- und Abwasserpreise wahrscheinlich steigen werden. Im Prinzip müssen wir mit den Ressourcen, die ins Gebäude hineinkommen besser haushalten und alles, was wieder hinausgeht, als Wertstoffe begreifen.
Dafür sind zunächst die klassischen Transparenzregeln anzuwenden: Verbräuche und Abfallmengen ganzjährig sichtbar machen und analysieren. Das Energiemanagement könnte sich in Richtung Ressourcenmanagement entwickeln. Mit einem CAFM-System (Anm.: Computer-Aided Facility Management - Unterstützung des Immobilienmanagements durch Informationstechnik) können wir Auffälligkeiten schnell erkennen und handeln.
Bisher herrschen ja eher Excel-Tabellen bei den Verwalter*innen vor…
Ja. Excel-Tabellen sind beherrschbar und bieten einen gewissen Charme, weil man sie einfach pflegen und auswerten kann. Allerdings hat BIM (Anm.: Building Information Modeling – Bauwerksdatenmodellierung mit Hilfe eines digitalen Zwillings) ein enormes Potenzial, besonders im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Mit BIM kennen wir die Position und Eigenschaften aller Bauteile sowie den Schichtaufbau. Das ist wie eine Inventur- oder Ersatzteilliste, die mit Ökobilanzdaten und Lebenszykluskosten verknüpft werden kann. Wir haben also einen riesigen Datenschatz, aber die Praxis zeigt, dass wir noch Schwierigkeiten haben, diesen zu nutzen.
BIM erfordert, dass alle am Bau Beteiligten von Anfang an zusammenarbeiten. Dieser Paradigmenwechsel ist eine Herausforderung. Ein weiteres Problem ist, dass ein digitaler Zwilling eines Gebäudes im Moment der Erstellung schon veraltet ist, weil sich ständig etwas verändert. Kleinere Änderungen sind nicht dramatisch, werden jedoch große Mengen an Bauteilen ausgetauscht, wird das Modell schnell ungenau. Die Aktualisierung eines BIM-Modells ist komplex und oft müssen Daten händisch nachmodelliert werden. Das stellt besonders die Betreiber der Immobilie vor große Herausforderungen.
Kann man solche Methoden auch auf ganze Quartiere oder gar Städte übertragen?
Wie wir mit einem heterogenen Gebäudebestand umgehen, ist eine Frage, die sich viele Kommunen stellen. Ein wichtiger Aspekt ist die suffiziente Nutzung. Wie kann man Fläche so nutzen, dass sie möglichst vielen Menschen und unterschiedlichen Nutzungen zur Verfügung steht? Das ist oft sinnvoller auf Quartiersebene, da man die Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen über den ganzen Tagesablauf hinweg berücksichtigen muss.
Wie kann man Investor*innen auch mit Hilfe von Kommunen und Energieversorger schon im Vorfeld überzeugen, dass sie nachhaltig und suffizient planen und bauen?
Suffizienz bedeutet, mit weniger Fläche die gleichen Bedürfnisse zu befriedigen. Besonders in Großstädten, wo Fläche knapp ist, kann das eine Lösung sein. Wir schaffen es nicht, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das ist weder machbar noch nachhaltig. Es geht aber nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern den Bestand sinnvoll zu nutzen und in lukrative Geschäftsmodelle für Investor*innen zu überführen. Ein Beispiel ist ein Büro in Amsterdam, wo ab 20 Uhr die Schreibtische hochgezogen werden und der Raum zum Yogastudio wird. Wir müssen Investor*innen zeigen, dass solche Modelle attraktiv und profitabel sein können.
Wir sollten dafür gemeinsam mit potenziellen Nutzern überlegen, wie Mehrfachnutzungen in einem Objekt gelingen können, welche zusätzlichen Aspekte zu beachten sind und wie man damit Geld verdienen kann. Das sind die Dinge, die Investor*innen am meisten interessieren.
Welche Kommunikationsstrategien sind dafür nötig? Und welche Stakeholder müssen einbezogen werden?
Es müssen viele verschiedene Akteure beteiligt sein: Planungsbüros, Nutzer*innen, Investor*innen, Bodeneigentümer*innen und Banken. Außerdem brauchen wir Nachhaltigkeitsberater*innen aus Wissenschaft und Praxis.
Ich denke, wir können einen Wandel im Mindset der Menschen v.a. durch positive Erfahrungen erreichen. Dazu muss es möglich sein, neue Konzepte einmal auszuprobieren, ohne sich zu etwas zu verpflichten. Bleiben wir bei modernen Bürokonzepten, wie dem Activity Based Office (Anm.: Bürokonzept und Organisationsstruktur mit aktivitätsbezogenen Arbeitsplätzen die Leistungsfähigkeit und Kreativität fördern). Aktuell schieben wir ein Projekt an, bei dem es darum geht, dass die Leute so ein Büro für eine gewisse Zeit ausprobieren können, ohne dass jemand sofort seinen Schreibtisch aufgeben muss. Sie können Feedback geben, was sie stört und was sie brauchen, um gut arbeiten zu können. Dieser Dialog ist entscheidend. Ähnliches gilt auch für Gebäude, die mit natürlichen Baustoffen gebaut sind. Es gibt viele Vorbehalte, aber wenn Leute die Innenraumqualität und Atmosphäre dieser Gebäude erleben, sind sie oft begeistert.
Kurzvita: Prof. Dr.-Ing. Anika Möcker
Prof. Dr.-Ing. Anika Möcker ist seit 2018 Professorin für Nachhaltiges Bauen und Betreiben an der Hochschule Mittweida. Ihre akademische Laufbahn begann sie als Doktorandin an der Technischen Universität Berlin, wo sie von 2010 bis 2015 im Fachgebiet Bauphysik und Baukonstruktionen forschte. Parallel dazu lehrte sie an der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin sowie der Baukammer Berlin in den Bereichen Facility Management und Nachhaltiges Bauen.
Beruflich war Prof. Möcker von 2015 bis 2018 bei der Daimler AG in Stuttgart tätig, wo sie sich auf die Real Estate Strategieentwicklung mit Schwerpunkt auf Lifecycle Management und Nachhaltigkeit konzentrierte. Zuvor arbeitete sie als freiberufliche Green Building Beraterin und war bei der Drees & Sommer GmbH Berlin im Projektmanagement und in der Green Building Beratung tätig. Ihre Karriere begann sie bei der SAP Deutschland AG im Bereich Real Estate und Prozessberatung.