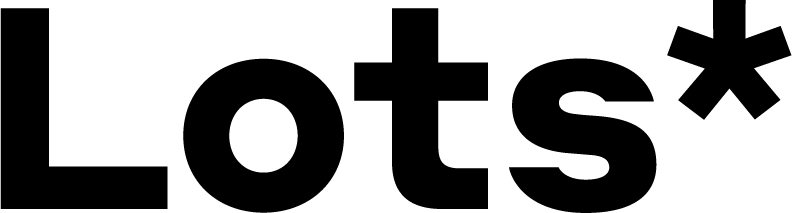Im Lots* Interview erklärt Klaus Preiser, Geschäftsführer des regionalen Energieversorgers badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG, welche Erfolgsfaktoren und Herausforderungen es in der Kommunikation von Tiefen- Erdwärme-Projekten gibt. Er gibt Einblicke in seine Erfahrungen auch im Umgang mit Vorurteilen und erklärt, welche Stakeholder*innen angesprochen werden müssen, damit solche Projekte eine breite Akzeptanz finden und letztlich auch realisiert werden können.
Zentrale Aussagen zur Kommunikation von Tiefe Erdwärme-Projekten
Geologie als Grundlage: Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die geologische Eignung des Standorts. Ohne ausreichend nutzbare geothermische Ressourcen im Untergrund kann selbst das beste Projekt nicht umgesetzt werden.
Gezielte und transparente Kommunikation: Vertrauen in die Tiefe Erdwärme-Technologie entsteht durch ehrliche, frühzeitige und kontinuierliche Kommunikation. Formate wie Bürgerschaftsräte, öffentliche Veranstaltungen und direkte Gespräche mit kritischen Stimmen sind dabei entscheidend.
Klare Differenzierung und Aufklärung: Die Abgrenzung der Tiefen Erdwärme von anderen Verfahren mit Themen wie „Fracking“ oder „Erdbeben“ ist essenziell. Positive Assoziationen – z. B. mit Thermalbädern – können gezielt genutzt werden, um Akzeptanz zu fördern.
Im Interview: Wie gelingt Akzeptanz? Erfolgsfaktoren für Tiefengeothermie-Projekte
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Tiefe Erdwärme-Projekte und welchen Einfluss hat die öffentliche Akzeptanz?
Klaus Preiser: Der größte Erfolgsfaktor ist die Geologie. Ohne ausreichende geothermische Ressourcen im Untergrund funktioniert kein Projekt, egal wie gut die Kommunikation ist. Der zweite entscheidende Faktor ist die klare Unterscheidung des hydrothermalen Verfahrens von den anderen Geothermie-Technologien. Man muss erst einmal Wissen vermitteln und eine Differenzierung am Anfang der Diskussion vornehmen. Bei uns im Projekt setzen wir auf Tiefe Erdwärme mit dem hydrothermalen Verfahren. Das ist sicher und erprobt und es ist nachhaltig. Und es ist herleitbar; Menschen kennen Thermalbäder und haben hier positive Assoziationen. Ziel ist, ein differenziertes Bild zum Thema zu vermitteln.
Wie kann man solchen Vorurteilen gegenüber der Erdwärme begegnen?
Die Erfahrungen etwa aus dem petrothermalen Verfahren in Basel und dem oberflächennahen Verfahren in Staufen waren einschneidend. In Basel wurde petrothermal gebohrt, also mit hohem Druck kaltes Wasser in undurchlässiges Gestein gepresst und dadurch wurden Erdbeben mit einer Magnitude von 3,2 ausgelöst. In Staufen – auch wenn es sich hier um oberflächennahe Geothermie handelte – führte eine nicht richtig abgedichtete Bohrung zur Bodenhebung. Das hat die Akzeptanz in unserer Region massiv beeinträchtigt. Beide Verfahren unterscheiden sich grundlegend von der hydrothermalen Nutzung der Erdwärme. Unser Ansatz war, ist und bleibt es, durch gezielte und transparente Kommunikation Vertrauen wieder aufzubauen.
Und das ließ sich gut umsetzen?
Ja. Wir haben eine Kommunikationsstrategie entwickelt, die auf Dialog setzt. Ein wesentlicher Bestandteil war die Gründung eines Bürgerschaftsrates mit zufällig ausgewählten Teilnehmer*innen. Diese Gruppe hat sich über Monate mit dem Thema auseinandergesetzt, Expert*innen befragt und ihre Ergebnisse selbst in die Kommunalpolitik getragen. Wir haben überdies umfassende öffentliche Veranstaltungen, eine Website und direkte Gespräche mit Stakeholder*innen organisiert.
Das sind schon jede Menge Beteiligte. Welche Stakeholder*innen sind aus Ihrer Sicht oft unterrepräsentiert, aber dennoch entscheidend?
Ortschaftsräte werden oft vergessen, obwohl sie vor Ort die ersten Ansprechpartner*innen sind. Auch Wasserversorger haben oft Bedenken, die man ernst nehmen muss. Zudem gibt es immer wieder Einzelpersonen, die gegen Geothermie im Allgemeinen sind und bei denen das hydrothermale Verfahren der Erdwärme noch nicht gegen die anderen Verfahren abgegrenzt ist. Das muss man transparent auf den Tisch bringen und (er)klären.
Ein weiteres oft diskutiertes Thema sind Haftungsfragen. Wie gehen Sie damit um?
Das Thema Haftung ist zentral und wird von uns ernst genommen. Wir werden entsprechende Versicherungen abschließen, es ist eine Ombudsstelle für den Streitfall geplant und wir arbeiten wie alle Unternehmen in diesem Bereich mit der Bergschadenskasse zusammen. Wichtig ist, die Unterschiede zwischen der wirtschaftlich orientierten Fündigkeitsversicherung für die Zeit der Bohrung und die Haftung für potenzielle Schäden klar zu kommunizieren.
Tiefe Erdwärme erfordert auch hohe Investitionen. Wie sichern Sie die Finanzierung?
Unser Unternehmen, die Badenova, hat die Projektentwicklung zunächst selbst gestemmt. Jetzt suchen wir gezielt nach Partner*innen, die Kapital und Know-how mitbringen. Wir sind ein kommunales Unternehmen, aber die Tiefe Erdwärme ist kein Kerngeschäft, daher brauchen wir Verstärkung.
Wird die Tiefe Erdwärme Ihrer Einschätzung nach auch als nachhaltige Energiequelle akzeptiert?
Wir setzen auf umfassende Aufklärung und bürgerschaftliche Beteiligung. Tiefe Erdwärme hat einen direkten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger. Neben dem Bürgerschaftsrat haben wir Informationsbroschüren in alle Haushalte verteilt, einen Info-Truck entwickelt und setzen auf Veranstaltungen direkt in den Gemeinden. Die Steuermehreinnahmen für Kommunen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. In der Summe spüren wir mittlerweile einen großen Rückhalt in der Region diese Technologie voranzutreiben und damit die Umstellung der Wärmeversorgung vom Einsatz fossiler Energie unabhängig zu machen.
Zum Abschluss: Was ist Ihr größter Lerneffekt aus der bisherigen Arbeit?
Kommunikation ist der Schlüssel. Ein Tiefe Erdwärme-Projekt kann an schlechter Kommunikation scheitern, selbst wenn alle technischen und wirtschaftlichen Faktoren stimmen. Ein Fehler kann ein Projekt kippen, und es braucht viele richtige Entscheidungen, um Vertrauen wieder aufzubauen.
Herzlichen Dank, Klaus Preiser, für das interessante Interview und die wertvollen Einblicke in die Kommunikation für Tiefe Erdwärme-Projekte.
Fazit: Die öffentliche Akzeptanz entscheidet maßgeblich über den Erfolg von Tiefe Erdwärme-Projekten. Stadtwerke und kommunale Energieversorger stehen in der Verantwortung, nicht nur technisch saubere, sondern auch gesellschaftlich tragfähige Projekte umzusetzen. Geschäftsführende in Stadtwerken müssen daher Kommunikation nicht als Nebenschauplatz, sondern als zentrales Steuerungsinstrument begreifen – und aktiv in bürgerschaftliche Beteiligung, transparente Informationsarbeit und den Dialog mit kritischen Stimmen investieren.

Das Interview mit Klaus Preiser fand statt im Zuge der bislang umfangreichsten Branchenumfrage zum Thema Kommunikation in Tiefengeothermie-Projekten. Diese wurde durchgeführt von Lots* und der ZfK – Zeitung für kommunale Wirtschaft.
Ergebnisse der Umfrage, Analysen und konkrete Handlungsempfehlungen - jetzt kostenlos herunterladen: