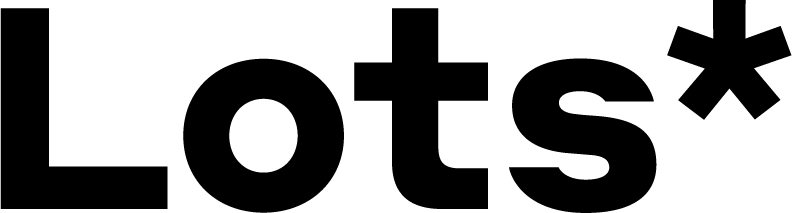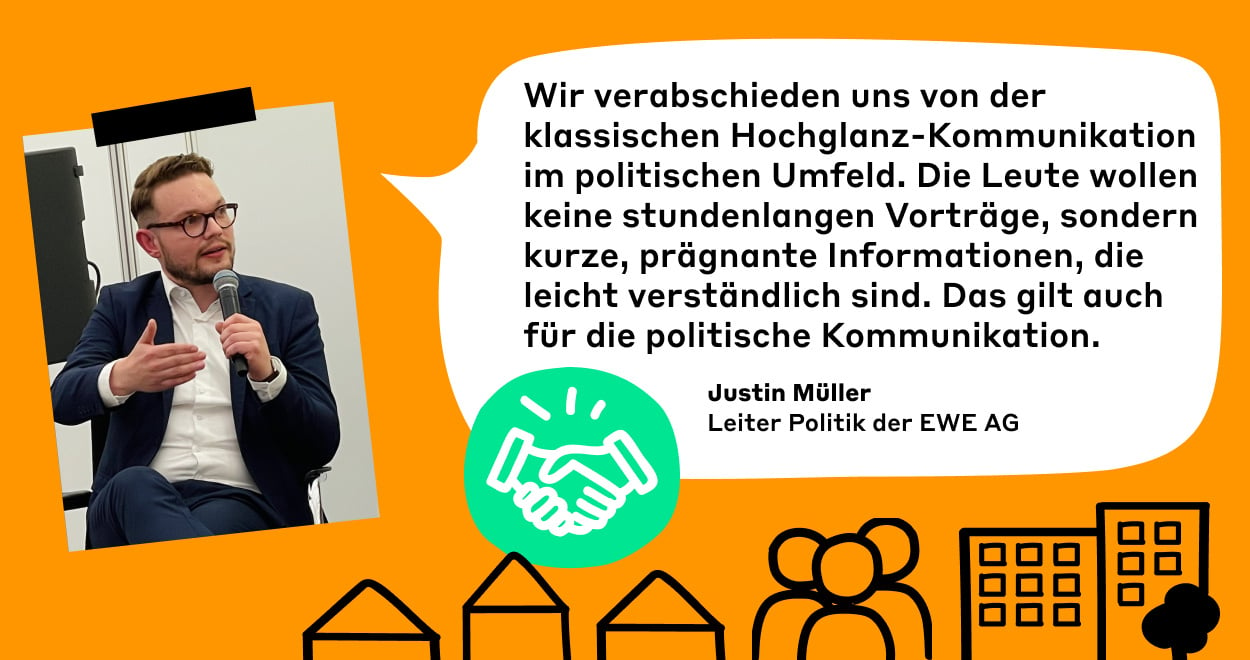Im Lots* Interview erklärt Justin Müller, Leiter Politik der EWE AG, wie Kommunikation aus Sicht eines regionalen Versorgers in Zeiten der Umbrüche funktioniert. Dabei zeigt er, warum transparente Kommunikation, regionale Vernetzung und neue Allianzen entscheidend für den Erfolg der Energiewende sind.
Die drei zentralen Aussagen zur Energiewende und Kommunikation
- Proaktive Kommunikation stärkt Vertrauen: Stadtwerke müssen proaktiv und transparent kommunizieren. Dialoge mit Kommunalvertreter*innen, zielgerichtete Informationskampagnen und persönliche Ansprechpartner*innen vor Ort stärken das Vertrauen in die Versorger.
- Lokal vernetzt, Widerstände frühzeitig erkennen: Technisches Know-how reicht nicht – regionale Gegebenheiten und Mentalitäten sind entscheidend. Durch enge Zusammenarbeit mit Kommunen, Gewerkschaften und anderen Akteur*innen lassen sich Hürden frühzeitig erkennen und gemeinsam Lösungen entwickeln.
- Neue Allianzen, moderne Kanäle: Digitale Formate und strategische Partnerschaften ersetzen klassische Kommunikationswege. Schnelle, verständliche und faktenbasierte Kommunikation ist entscheidend, um politische Entscheidungsträger*innen und die Öffentlichkeit gleichermaßen zu erreichen.
Vorab: Wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern, hat das auch Auswirkungen auf die Versorgungsunternehmen. Wie positioniert sich EWE, um ihre Rolle als Treiber der Energiewende und kommunale Daseinsvorsorge zu stärken?
Das verbinden wir mit einem klaren Anspruch an Versorgungssicherheit. Und genau mit dieser Haltung begegnen wir auch den veränderten politischen Anforderungen – zum Beispiel der Klimaneutralität. Von diesem Punkt ausgehend schauen wir in die Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, ein intelligentes, systemisches, aber auch kosteneffizientes Energiesystem zu entwickeln.
Welche langfristigen Kommunikationsstrategien und spezifischen Formate sind dazu notwendig?
Unser Versorgungsgebiet reicht grob von Holland bis Hamburg. Deshalb arbeiten wir mit einer Kombination aus Kommunalbetreuer*innen und Regionsleiter*innen. Unsere Kommunalbetreuer*innen sind als Ansprechpartner vor Ort präsent und wohnen oft auch privat in den Regionen. Die Regionalleiter*innen treiben übergeordnete Themen voran, schaffen Synergieeffekte und Strukturen, die ich als eine Art kommunales Key Accounting bezeichnen würde. Es geht uns dabei nicht um kurzfristigen Erfolg oder schnelle Abschlüsse, sondern um langfristige Zusammenarbeit, denn die Energiewende und Transformation sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben.
In unserer Kommunikation setzen wir zum einen auf klassische Formate wie kommunale Briefe, die an Ratsmitglieder, Kreistagsabgeordnete, Bürgermeister*innen, Landrät*innen und Verwaltungen verschickt werden. Wir haben aber auch neue Formate etabliert, wie zum Beispiel ‚Kommunal Kompakt‘. Das ist ein digitales Format, das wir vor zwei Jahren eingeführt haben. In maximal 45 Minuten bringen wir Vertreter*innen aus der kommunalen Spitzenpolitik oder Verwaltung mit unseren Expert*innen zusammen, um ein spezifisches Thema zu diskutieren. Das Ganze ist interaktiv – die Teilnehmer*innen können Fragen stellen, die in der Moderation aufgegriffen werden. Es ist ein wenig wie eine Talkshow, nur digital und dialogorientiert.
Daneben gibt es viele regionale Veranstaltungen. In der Hochphase der Energiekrise haben wir unter dem Motto ‚Fakten statt Fake‘ Aufklärung betrieben, um die Preisentwicklungen zu erklären und in einer aufgeheizten Stimmung sachliche Orientierung zu bieten.
Die EWE integriert ihr Wissen über lokale Gegebenheiten in Projekte. Ist das ein Mittel, um von den Kommunen als unverzichtbarer Partner wahrgenommen zu werden?
Das Hoheitswissen vor Ort ergibt sich aus verschiedenen Aspekten. Auf der einen Seite geht es um die rein technischen Gegebenheiten: Wie sind die Netze beschaffen? Wie ist die Gebäudeinfrastruktur? Wo stehen wir bei der kommunalen Planung und der Bestandsaufnahme? Dazu gehört auch, die Netzentwicklungspläne zu kennen und zu wissen, wie diese mit benachbarten Kommunen abgestimmt sind.
Denn im schlimmsten Fall haben wir am Ende 330 unterschiedliche kommunale Wärmeplanungen in unserem Versorgungsgebiet – das wäre ineffizient und könnte zu parallelen Infrastrukturen führen, die die Bezahlbarkeit beeinträchtigen. Die technische und infrastrukturelle Expertise ist daher essenziell.
Mindestens genauso wichtig sind die Einstellung und Mentalität vor Ort. Ich lebe selbst in einer kleinen Gemeinde und weiß, wie die Leute dort ticken. Es gibt unterschiedliche Kulturen und Denkweisen, die man berücksichtigen muss. Es geht auch immer um Fragen wie: Sind die Menschen offen für neue Lösungen wie Wärmepumpen oder Nahwärmeversorgung? Sind sie bereit, Infrastrukturbelastungen hinzunehmen oder Flächen für Windparks zu akzeptieren? Ohne diese Akzeptanz laufen wir Gefahr, die Bürger*innen abzuhängen.
Durch die Berücksichtigung beider Aspekte – technisches Wissen und das Verständnis für die Mentalität vor Ort – haben wir, glaube ich, einen gewissen Vorteil.
Erfolgsfaktor Kommunikation: Wie Stadtwerke Mehrheiten gewinnen
Stadtwerke gestalten die Energiewende nur dann vor Ort erfolgreich, wenn sie die Politik aktiv einbinden, überzeugen und strategisch bespielen. Doch wie erreichen Stadtwerke politische Entscheidungsträger und Bürger? Unser Whitepaper zeigt praxisnahe Strategien und bewährte Formate.
Das sind immer sehr unterschiedliche Akteure. Mit welchen Formaten und Kommunikationskanälen kann man sie effektiv ansprechen?
Zum einen sehen wir uns heute stärker als Partner der Kommunen. Wir kommen aus einer monopolistischen Rolle, haben uns aber kulturell gewandelt. Heute sind wir ansprechbar und müssen uns bewerben – ob wir am Ende den Zuschlag für ein Projekt bekommen oder nicht. Das gehört zu unserer unternehmerischen Verantwortung für die Region. Man kann uns anrufen, uns schreiben – sogar per WhatsApp.
Ein weiterer Punkt ist, Informationsdefizite abzubauen. Es geht darum, zu erklären, warum bestimmte Dinge notwendig sind. Dafür nutzen wir offizielle Kanäle wie die EWE-Accounts, aber auch persönliche Plattformen. Ich selbst nutze meinen privaten LinkedIn- und Instagram-Account, um regelmäßig Inhalte zu posten: Wofür steht EWE? Was ist unsere Haltung?
Gerade im politischen Kontext – unabhängig von Parteizugehörigkeit – ist Transparenz entscheidend. Wenn man aufklärt, Fakten liefert und dabeibleibt, erreicht man unterschiedliche Akteure in verschiedenen Lebenssituationen.
Da Sie ja nah an den Bürger*innen sind: Welche Maßnahmen und Frühwarnsysteme helfen dabei, auf politische und gesellschaftliche Widerstände frühzeitig zu reagieren?
Wir setzen auf regionales Medienmonitoring. Das heißt, wir beobachten auch kleinere Zeitungen und greifen Themen auf – sei es durch einen Gastkommentar oder andere Hinweise. Wenn wir merken, dass sich etwas entwickelt, diskutieren wir das zentral und entwickeln entsprechende Strategien.
In den letzten Jahren hat sich bei uns kulturell viel verändert. Früher hatten wir oft eine klassische „Grünmeldementalität“, die im Management oft ein optimistisches Bild erzeugte, als es in Realität vor Ort war. Heute haben wir eine viel offenere und transparentere Unternehmenskultur. Das heißt, wenn irgendwo Protest entsteht, suchen wir nicht nach Fehlern, sondern nach Lösungen.
Unser Medienscreening hilft uns dabei, aber ebenso der direkte Kontakt: über Kommunalbetreuer, Regionsleiter oder auch durch unsere Präsenz in der Region. Ich selbst bin viel vor Ort und bekomme so mit, was die Menschen bewegt.
Gerade in Krisenzeiten, wie bei den Preisbremsen, mussten wir alle viel Lehrgeld zahlen – die Politik, andere Energieunternehmen und auch wir. Vertrauen wurde verspielt. Aber durch Verständnis, Aufklärung und die Bereitschaft, Fehler einzugestehen, können wir daran arbeiten, dieses Vertrauen zurückzugewinnen.
Ein Beispiel: Eine ältere Dame, über 80 Jahre alt, kam mit einem Ordner voller Unterlagen zu mir. Sie war völlig überfordert mit den komplexen Schriftstücken zu den Preisbremsen, Datenschutzanhängen und Erklärungen. Das sind Dinge, die viele Menschen überfordern – mich eingeschlossen. Wir haben uns die Zeit genommen, alles durchzugehen, und genau so etwas spricht sich gerade im ländlichen Raum herum. Erreichbarkeit und Nähe sind dort besonders wichtig.
Das geht ja nicht ohne den Lokaljournalismus…
Ich finde den Lokaljournalismus extrem wichtig, weil er ein großes Zeichen der Wertschätzung ist – gerade für Ehrenamt und lokale Aktivitäten. Er zeigt, was vor Ort passiert, was man sonst nicht mitbekommt. Leider wird er zurückgehen, weil viele Menschen nicht mehr bereit sind, dafür Geld auszugeben.
Der professionelle Lokaljournalismus, wie wir ihn kennen, wird sich stark verändern. Print wird weniger relevant, stattdessen wird sich vieles in den digitalen Raum verlagern. Wochenblätter oder Ehrenamtszeitungen wird es vor Ort noch geben, aber professioneller Journalismus wird sich in Richtung Live-Formate und kurzweilige, digitale Inhalte bewegen.
Beispiele sind mobile Redaktionen, die direkt aus der Region berichten, oder Live-Streams über Plattformen wie Instagram oder Facebook. Die Vernetzung über digitale Kanäle wird entscheidend sein. Das wird den Lokaljournalismus stark prägen.
In unserer Region gibt es auch das Zukunftsfestival Gromorrow. Hier wurde in der Region mit hochrangigen und prominenten Expert*innen über die Zukunft diskutiert und immer auch mit den Akteuren vor Ort: Kommunalpolitik, Hochschulen, Unternehmen und weiteren Machern. Dadurch entsteht regionale Wertschätzung für das Geleistete durch die Bekanntheit, aber auch ein übergeordneter Sinn: Wir alle leisten unseren Beitrag für die Zukunft - und das ist wertvoll.
Wenn es trotzdem im Fall der Fälle Widerstände gibt: Wie gehen Sie damit proaktiv um?
Ein wichtiger Ansatz ist, frühzeitig den direkten Austausch zu suchen – noch bevor ein Konflikt entsteht. Dafür führen wir Gespräche außerhalb von Ausschusssitzungen und dem öffentlichen Raum, weil das erfahrungsgemäß effektiver ist. Unsere Kommunalbetreuer*innen vor Ort und die Expert*innen, die sie begleiten, spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Expert*innen haben oft das Fachwissen, das benötigt wird, um Ängste und Sorgen mit Fakten und ehrlichen Einschätzungen abzubauen. Spekulationen führen zu Unsicherheiten und die kann man im bilateralen oder informellen Austausch frühzeitig ausräumen.
Solche Gespräche sind wichtig, weil in offiziellen Sitzungen die Hemmschwelle oft höher ist – da achtet jeder auf jedes Wort, um keine Missverständnisse zu riskieren. In informellen Gesprächen kann man dagegen auch mal direkt nachfragen: ‚Was ist hier das Problem?‘ Oft sind es Kleinigkeiten, wie etwa falsch interpretierte Landesvorschriften. Hier konnten wir schon mehrfach helfen, indem wir Kommunen miteinander vernetzt haben, damit sie voneinander lernen.
Auch bei Themen wie Infrastrukturbelastungen oder Bürger*innenbeteiligung, zum Beispiel im Bereich Windkraft, gehen wir offen und ehrlich vor. Wir zeigen Potenziale auf, aber wir sagen auch, wenn es mal schwierig wird. Es bringt nichts, sich in Euphorie zu reden und dann gegen eine Wand zu laufen. Offenheit und Einordnung in den größeren Kontext sind entscheidend.
Deshalb haben wir die Initiative ‚Powerhouse Nord‘ ins Leben gerufen, die wir in 2024 und 2025 mit einer Anschubfinanzierung an den Start gebracht haben. Sie soll die Energiewende in unserer Region vorantreiben, die als ‚Potenzialregion‘ bezeichnet wird. Dabei geht es um mehr als Energie: Gewerbeansiedlung, Gesundheitsversorgung, Fachkräftemangel und Wertschöpfung vor Ort spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Wir bringen dazu alle relevanten Akteure – Kommunen, Gewerkschaften, wissenschaftliche Einrichtungen – an einen Tisch, denn es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir können die Potenziale für uns als Region nur gemeinsam heben – Energiewende ist ein Auslöser, aber noch nicht das Ende.
Unser Ziel ist, ehrlich zu sagen, wenn es weh tut, und gleichzeitig die Chancen aufzuzeigen. Das kommt erstaunlich gut an. Nur die schönen Seiten hervorzuheben, reicht nicht – die Menschen erwarten Ehrlichkeit und Transparenz und verdienen diese auch.
Transparenz heißt auch faktenbasierte Botschaften. Wie kann man dabei politisch neutral bleiben, damit eine breite Akzeptanz bei politischen Akteuren und der Bevölkerung gefunden wird?
Ein konkretes Beispiel ist die Wärmepumpe. Rein formal ist sie tatsächlich die effizienteste Lösung. Ab 2027 wird sie sich, je nach Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, auch wirtschaftlich noch stärker lohnen. Mit einer PV-Anlage könnten sich Betriebskosten noch deutlicher reduzieren.
Allerdings hat die Wärmepumpe in der Vergangenheit – insbesondere in der Zeit des sog. Heizungsgesetzes (GEG) – an Image gelitten. Das lag auch an handwerklichen Schwächen und mangelnden Konsultationen der Bundespolitik. Eine offene Kommunikation und längere Fristen hätten helfen können. Es ist wichtig, solide Energiepolitik nicht über Stilmittel wie kurzfristige Fristen zu gestalten.
Wir haben das Thema mit dem SPD-Abgeordneten Markus Hümpfer aus Bayern aufgegriffen und eine Metastudienanalyse durchgeführt. Dabei haben wir diverse Studien von verschiedenen Instituten, vom Öko-Institut bis hin zu BCG und McKinsey, ausgewertet. Die Gemeinsamkeiten haben wir in einem Gastbeitrag zusammengefasst und sachlich aufgearbeitet. Dieser Beitrag erschien in der Zeitung für Kommunales ZfK, der reichweitenstärksten Zeitung im kommunalen Umfeld, um nicht nur Kommunen, sondern auch Versorger vor Ort zu erreichen.
Viele Stadtwerke haben weder die Ressourcen noch die Kapazitäten, solche Analysen selbst durchzuführen. Daher war es uns wichtig, ihnen Fakten und Argumente an die Hand zu geben, um vor Ort fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Als Unternehmen bewerten wir dabei nicht politisch, sondern liefern Fakten. Es ist nicht unsere Rolle, Politik zu machen – wir beraten und die Politik entscheidet. Dieser Blick in die Praxis ist entscheidend, um Fortschritte zu erzielen.
Welche Kompetenzen und internen Strukturen müssen Sie hierzu bei EWE stärken?
Als ich den Bereich übernommen habe, haben wir eine klare Schärfung vorgenommen – insbesondere in der politischen Analyse. Früher gab es eine gewisse Trennung zwischen denen, die nach außen kommunizieren, und denen, die Inhalte erarbeiten. Das funktioniert nicht, denn gute Botschaften können nur auf einer soliden inhaltlichen Basis entstehen.
Wir haben klare Richtlinien eingeführt: Positionen gegenüber der Politik formulieren wir auf maximal zwei Seiten – prägnant und auf den Punkt. Wir kritisieren niemals ohne Gegenvorschlag. Es ist respektlos, nur zu sagen ‚das ist schlecht‘, ohne eine konstruktive Alternative zu bieten. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber wer Verantwortung übernehmen will, muss konstruktiv mitdiskutieren.
Um alle Ebenen einzubinden, führen wir wöchentliche Briefings durch, die montags spätestens um 9 Uhr vorliegen. Sie bieten dem Top-Management und den Expert*innen den Überblick über die relevanten Themen der Woche. Das Ziel: alle politisch handlungsfähig zu machen und auf Fragen vorbereitet zu sein.
Auch unsere Governance haben wir angepasst. Wenn kurzfristig politische oder gesellschaftliche Entscheidungen nötig sind, können wir innerhalb eines Tages Grundsatzentscheidungen herbeiführen.
Die Geschäftsführung braucht ja sicher bei der Ansprache politischer Entscheidungsträger kommunikative Schützenhilfe…
Wir fordern nicht einfach abstrakt den Bürokratieabbau, sondern benennen klar, welche Vorschriften geändert werden sollten. Dabei laden wir auch zur Debatte ein. Drei Dinge sind entscheidend:
Erstens, die Botschaft muss konkret und prägnant sein.
Zweitens, sie muss nachvollziehbar bleiben – für Politik, Gesellschaft und Medien. Ein 600-seitiges Dokument beeindruckt niemanden. Stattdessen braucht es klare Kommunikation, die die Sprache der Zielgruppe spricht.
Und drittens: Unternehmen müssen nach außen anders kommunizieren als innerhalb ihrer eigenen Strukturen. Technische Details wie ‚Blindleistungs-Energieverlust‘ mögen intern sinnvoll sein, aber extern versteht das kaum jemand. Die Botschaft muss vereinfacht werden, ohne dabei falsch zu sein, damit sie auch in der Außenwelt ankommt.
Sehen Sie auch deswegen grundsätzliche Änderungen in der Kommunikation Ihres Unternehmens in der Zukunft?
In der politischen Kommunikation und als Unternehmen dürfen wir uns nicht nur auf kurzfristige Marktoptimierung fokussieren. Zukünftig wird es noch wichtiger, in Allianzen zu denken, Zugeständnisse zu machen und gemeinsam mit anderen eine Botschaft zu vertreten. ‚Fakten statt Fake‘ gilt auch hier: Wenn viele gemeinsam eine klare Botschaft senden, hat das deutlich mehr Gewicht als Einzelstimmen.
Ein aktuelles Beispiel: Im Januar haben wir uns mit Verdi und unseren Betriebsräten zusammengesetzt. Eigentlich klang das Treffen hinterher auf dem Papier nicht optimal, aber es war einer der besten Termine der letzten Monate. Warum? Weil wir offen gesprochen haben. Oft reicht ‚ein bisschen schnacken‘, um Probleme zu lösen.
Konkret ging es um das Problem, dass die Bundesnetzagentur bestimmte Aus- und Weiterbildungskosten nicht mehr in der bisherigen Form anerkennen möchte. Das ist absurd, denn diese Kosten sind für die Transformation – gerade im Gasnetzbereich – essenziell. Gemeinsam mit Verdi und den Betriebsräten haben wir uns darauf geeinigt, eine Resolution zu erarbeiten, um gegenüber Politik und Öffentlichkeit geschlossen aufzutreten.
Solche Allianzen, auch mit eher ungewöhnlichen Partnern, werden in Zukunft immer wichtiger – nicht nur intern, sondern auch extern. Zusammenarbeit und gemeinsame Kommunikation mit anderen Akteuren und Organisationen werden entscheidend sein, um relevant zu bleiben.
Das klingt nach unkonventionellen Wegen…
Die Kommunikation wird intelligenter, pragmatischer und kurzweiliger. Das bedeutet, auch mal schnell etwas rauszuhauen oder neue Wege wie Instagram zu nutzen. Anfangs gab es dazu gemischte Meinungen, aber wir haben es als Chance gesehen. Unsere Aufsichtsräte und Anteilseigner verfolgen solche Formate mit Interesse, und es hat sich gezeigt, dass pragmatischere Ansätze funktionieren.
Wir verabschieden uns von der klassischen Hochglanz-Kommunikation im politischen Umfeld. Die Leute wollen keine stundenlangen Vorträge, sondern kurze, prägnante Informationen, die leicht verständlich sind. Das gilt auch für die politische Kommunikation. Künftig werden wir mehr mobile Formate, Podcasts oder Live-Formate sehen, die auch parteiübergreifend funktionieren.
Ein herzlicher Dank an Justin Müller für das aufschlussreiche Interview und seine wertvollen Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der politischen Kommunikation in der Energiewende.
Fazit: Wie gestalten Stadtwerke die Energiewende mit?
Wer die Energiewende erfolgreich mitgestalten will,
- muss über klassische PR hinausdenken und
- Kommunikation als strategisches Werkzeug nutzen.
Transparenz, regionale Vernetzung und digitale Formate sind dabei entscheidend, um politische Akteur*innen, Kommunen und Bürger*innen zu überzeugen.
Justin Müller, geboren 1992 in Norden, ist seit August 2022 Leiter Politik der EWE AG und verantwortet neben der politischen Kommunikation und Positionierung des Gesamtkonzerns auch die Allianz „Powerhouse Nord“ sowie das gesamte Verbände- und Allianzmanagement. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen in der Energiewirtschaft tätig, unter anderem als Leiter Politik, Kommunikation und Marketing bei Alterric, einem der größten Wind-Onshore-Projektierer Europas, sowie als Leiter des Venture Capital Arms der EWE AG. Müller ist studierter (Energie-)Ökonom (M.Sc.) und lebt in der Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland - mitten im Versorgungsgebiet des EWE-Konzerns.
Wie Stadtwerke Mehrheiten für die Energiewende gewinnen
Digitale und interaktive Formate sind der Schlüssel, um politische Akteur*innen und Bürger*innen zu erreichen. Wie Stadtwerke ihre Kommunikationsstrategie anpassen sollten, lesen Sie in unserem Whitepaper “Kommunikation im politischen Raum”.